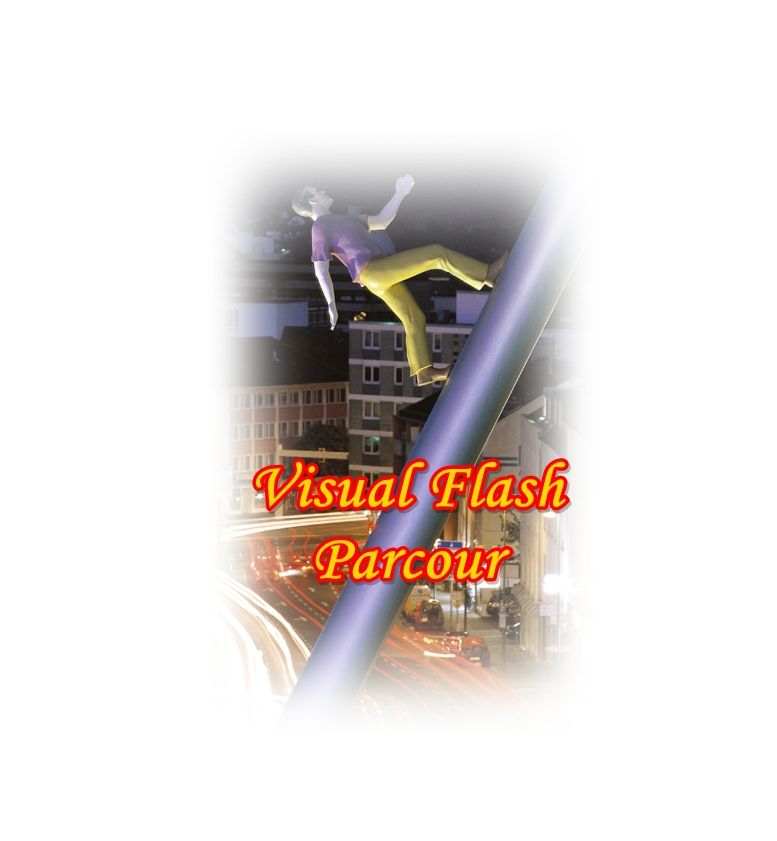ASTRONOMISCH-PHYSIKALISCHES KABINETT
Die landgräfliche Sammlung wissenschaftlicher Instrumente verdankt ihre Entstehung einer kontinuierlichen Förderung der Naturwissenschaften durch die hessischen Landgrafen. Die fünf Ausstellungsbereiche Astronomie, Uhren, Geodäsie, Physik und Mathematik/Informationstechnik führen dem Besucher die ganze Bandbreite der entstehenden messenden Naturwissenschaften von der Spätrenaissance bis zum Vorabend der industriellen Revolution vor Augen. Sekundenpendeluhren, Vakuumpumpen, Mikroskope, Elektrisiermaschinen, frühe Rechenmaschinen und Quadranten wurden von den Landgrafen für Lehr- und Forschungszwecke angeschafft. Mechanische Himmelsgloben und astronomische Kunstuhren halfen wie die heutigen Planetarien durch ihre uhrwerksgetriebene Simulation der Himmelsbewegungen den Kosmos zu verstehen, dienten aber zudem als Pretiosen des Wissens, in denen sich Kunst und Naturwissenschaft zu einem einheitlichen Ganzen vereinigen.
Physik
Die experimentelle Physik wurde im 18. Jahrhundert zum entscheidenden Motor der wissenschaftlichen Revolution. Vakuumexperimente, die Entdeckung elektrischer Phänomene und die vielen Facetten der Newtonschen Mechanik und der Optik faszinierten viele Herrscher in ganz Europa. Das physikalische Kabinett mit seinen Schauversuchen galt bei Hof als wissenschaftliches Theatrum mit hohem Unterhaltungswert. Kassel ist durch die Tätigkeit Denis Papins eine der frühesten Orte der entstehenden Experimentalphysik. Landgraf Carl, der vom Nutzen der Naturwissenschaften für Land und Volk überzeugt war, gründete 1709 das Collegium Carolinum. Ihm schwebte ein Mittelding zwischen naturwissenschaftlicher Lehranstalt und wissenschaftlicher Sozietät vor, die sich ähnlich der Royal Society of London den experimentellen Wissenschaften verschrieben hat. herausragendste Objekte in der Ausstellung sind die Vakuumpumpe von Musschenbroek, der Brennspiegel von Tschirnhaus, und eine Vielzahl mechanischer Demonstrationsapparate, gestaltet nach Abbildungen ins Gravesandes Lehrbuch „Physices Elementa Mathematica“ von 1721.
Astronomie
Die Ausstellung zeigt Instrumente aus drei Jahrhunderten astronomischer Forschung. Die ältesten Objekte stammen aus der Zeit Landgraf Wilhelms IV., der zwischen 1560 und 1592 auf einem balkonartigen Anbau des Stadtschlosses den Fixsternhimmel mit bislang unbekannter Präzision vermaß. Die Rekonstruktion dieses Anbaus mit den damals verwendeten Messinstrumenten ist das Herzstück des Ausstellungsbereichs. An Replikationen eines Torquetums und eines Sextanten kann der Besucher selbst einen künstlichen Sternenhimmel vermessen. Filigran gearbeitete astronomische Uhren der Hofuhrmacher Eberhard Baldewein und Jost Bürgi, sowie Fernrohre und Himmelsgloben versetzen den Besucher in die Zeit der copernicanischen Revolution und materialisieren abstrakte chronologische wie kosmologische Kontexte.
In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts erlangte Kassel ein weiteres Mal unter den Astronomen seiner Zeit einen hohen Bekanntheitsgrad. Landgraf Friedrich II. richtete in den Jahren zwischen 1784 und 1787 auf dem Zwehrenturm direkt neben seinem Museum Fridericianum ein. Diese Sternwarte ist ebenfalls rekonstruiert und für den Besucher begehbar. Hier dominieren ein Mauerquadrant der Firma Breithaupt, sowie englische Quadranten, Fernrohre und Sektoren feinster Machart. Mit diesen Geräten wurden die Bahnen der planetaren Monde vermessen und neuentdeckte Planetoiden und Planeten beobachtet.
Mathematik und Informationstechnik
Die Mathematik galt von jeher als Schlüssel zur Präzision im Denken und Handeln. Neben dem Aufschwung der experimentellen Wissenschaften ist die erdrutschartige Mathematisierung aller Bereiche der Naturwissenschaft ein Hauptkennzeichen der wissenschaftlichen Revolution. Prunkvolle mathematische Besteckkästen symbolisierten die Teilhabe der Herrscher an diesen Innovationsprozessen ebenso, wie sie eine Allegorie auf deren Präzision und Unfehlbarkeit an sich darstellen. Die Idee, das Rechnen zu mechanisieren, führte zur Konstruktion von ersten Rechenmaschinen, meist für die Grundrechenarten. Im 20. Jahrhundert revolutionierte die Informationstechnik zunehmend die Wissenschaften aber auch den Alltag des Menschen. Die Ausstellung gründet auf zwei Säulen: Die erste Säule stellen die analogen Rechengeräte, wie Besteckkästen, Zirkel und auch erste Rechenmaschinen und frühe Computer dar. Die zweite Säule bilden die digitale Entwicklung des 20. Jahrhunderts. Der Besucher erfährt hier besonders eingängig, wie sich Computer und Speichermedien in der verschwindend kurzen Zeitspanne von einem halben Jahrhundert verkleinert haben, bei gleichzeitiger beliebig erscheinender Leistungssteigerung.
Geodäsie
Die Landvermessung spielte im frühneuzeitlichen Staat eine wichtige Rolle. Genaue Karten waren für das Steuersystem sowie für militärische Zwecke von grundlegender Bedeutung. Aber auch in den vielen hessischen Bergwerken kam man ohne exakte Vermessungen nicht aus. Kein Wunder also, dass Landgraf Carl sich selbst mit der Entwicklung geodätischer Instrumente beschäftigt hat. Die Ausstellung enthält eine ungewöhnlich vielseitige Sammlung unterschiedlichster Vermessungsinstrumente. Die einfache Schönheit des Triangularinstruments von Jost Bürgi verdeutlicht dem Besucher, mit welch einfachen mathematischen Mitteln man Entfernungen messen kann. Komplizierter wird es bei den Messtischen für die Landaufnahme: Kaum eine andere europäische Sammlung kann dem Besucher eine solche Vielfalt unterschiedlichster Ausgestaltungen ein und desselben Instrumentengattung bieten. Ein weiteres Highlight sind die Theodoliten und Nivelliere des 19. Jahrhunderts. Sie versetzen den Besucher in die Zeit der großen Landvermessungen und des Eisenbahnbaus, der ohne geodätische Instrumente nicht möglich gewesen wäre.

Uhrenkabinett
Das Uhrenkabinett entführt Sie in die mannigfaltige Welt der Zeitmessung. Sonnenuhren, Wasseruhren, Sanduhren und mechanische Uhren verdeutlichen den Fortschritt in der Messtechnik. Sie bieten in ihrer Vielzahl und Vielfältigkeit aber auch einen Einblick in die Sammelleidenschaften der hessischen Landgrafen. Die Ausstellung vereinigt so ziemlich alles, was in der Uhrentechnik der Frühen Neuzeit Rang und Namen hat. Bei den Sonnenuhren dominiert der Heliograph von Rowley, mit dem die wahre Sonnenzeit ohne Schwierigkeiten auf die Minute genau abgelesen werden kann. Bei den Tischuhren fällt besonders Jost Bürgis Kreuzschlaguhr ins Auge. Ein mechanischer Maikäfer, dessen Flügel, Fühler und Beine mit Hilfe eines Uhrwerkes angetrieben werden, bringt dem Besucher nahe, wie eng das mechanistische Weltbild des 17. Jahrhunderts mit der Entwicklung der Uhrentechnik verbunden war. Die vorführbereiten Turmuhrwerke vermitteln eingängig die Fortschritte in der Uhrentechnik.